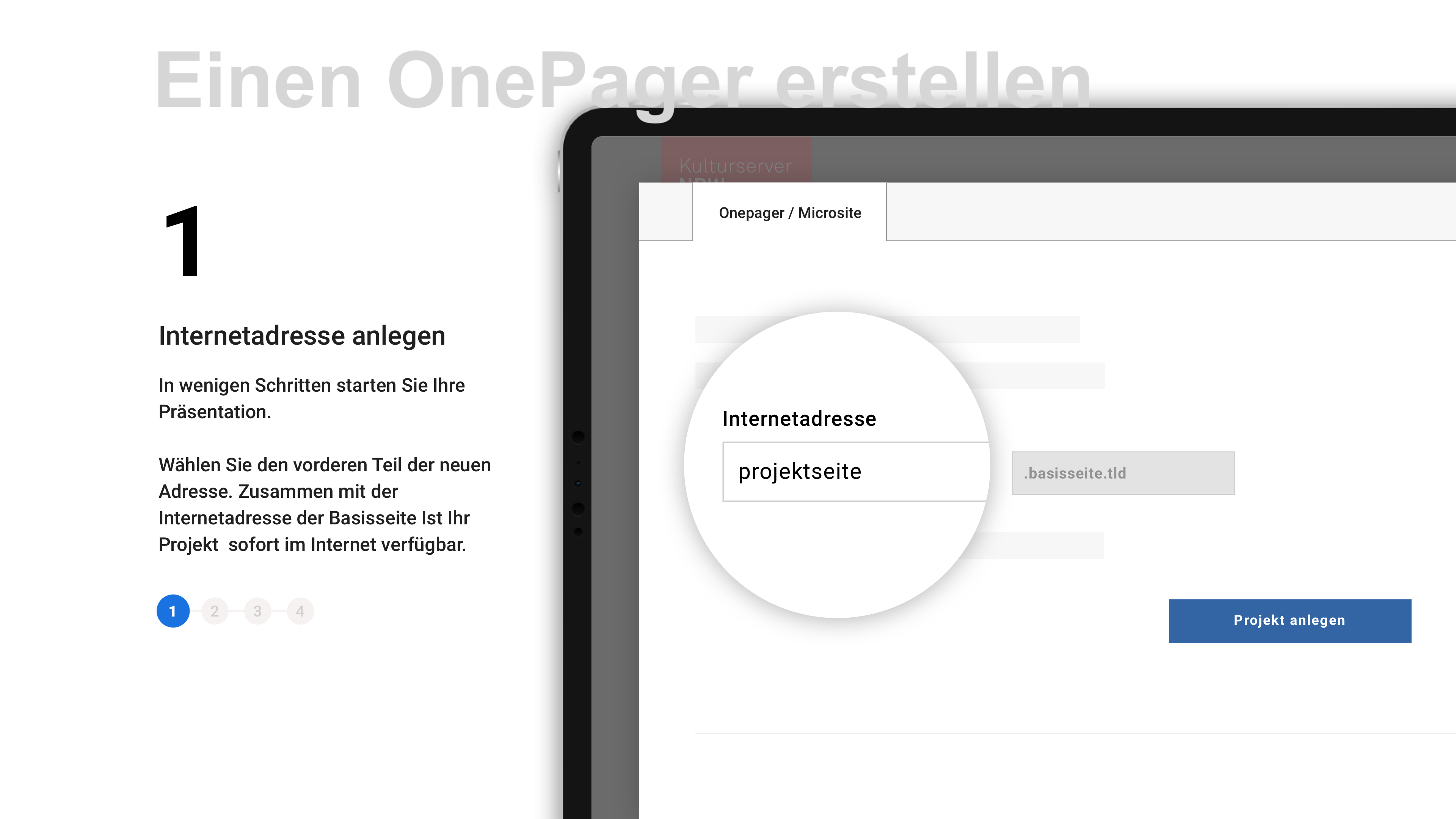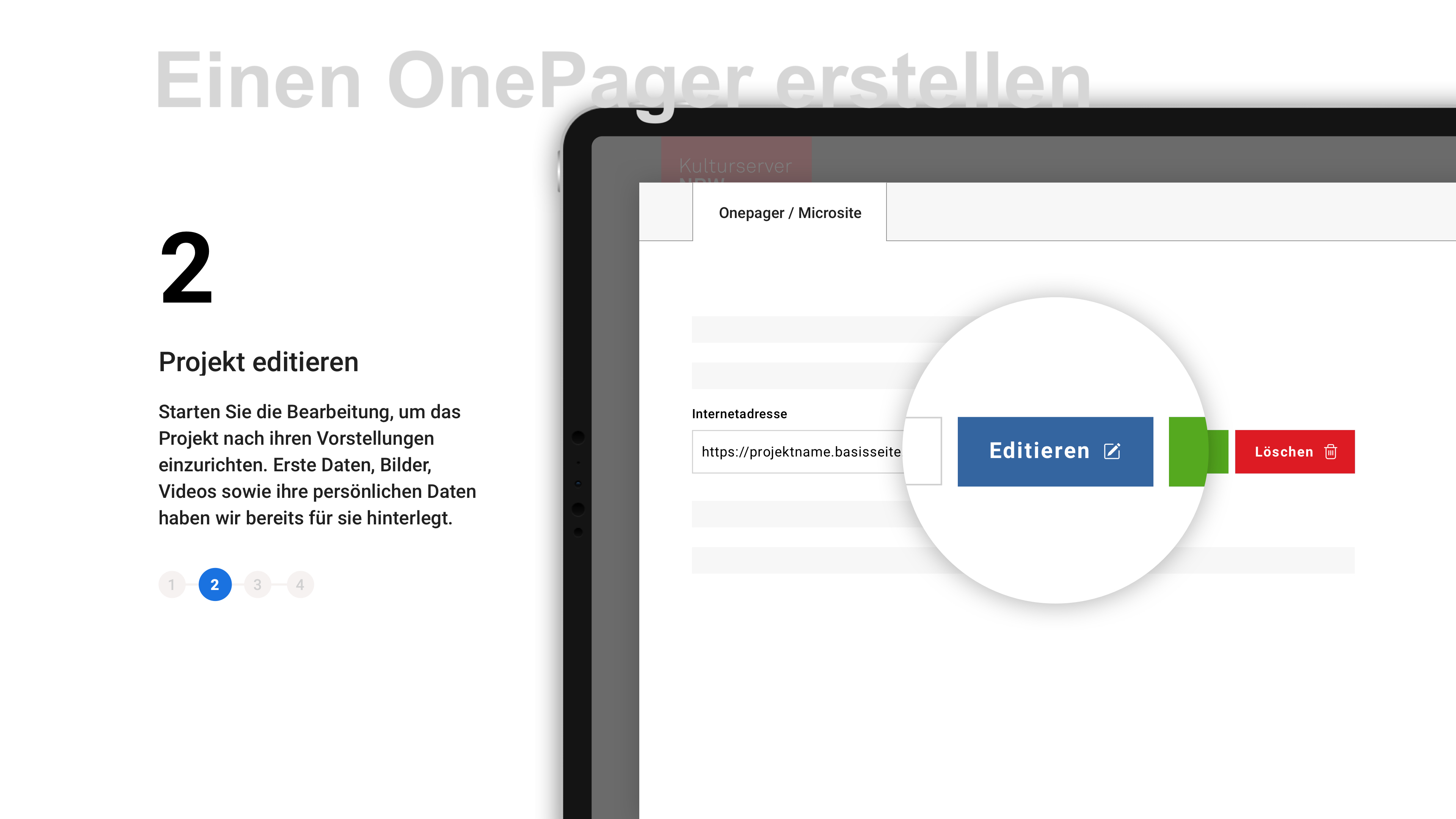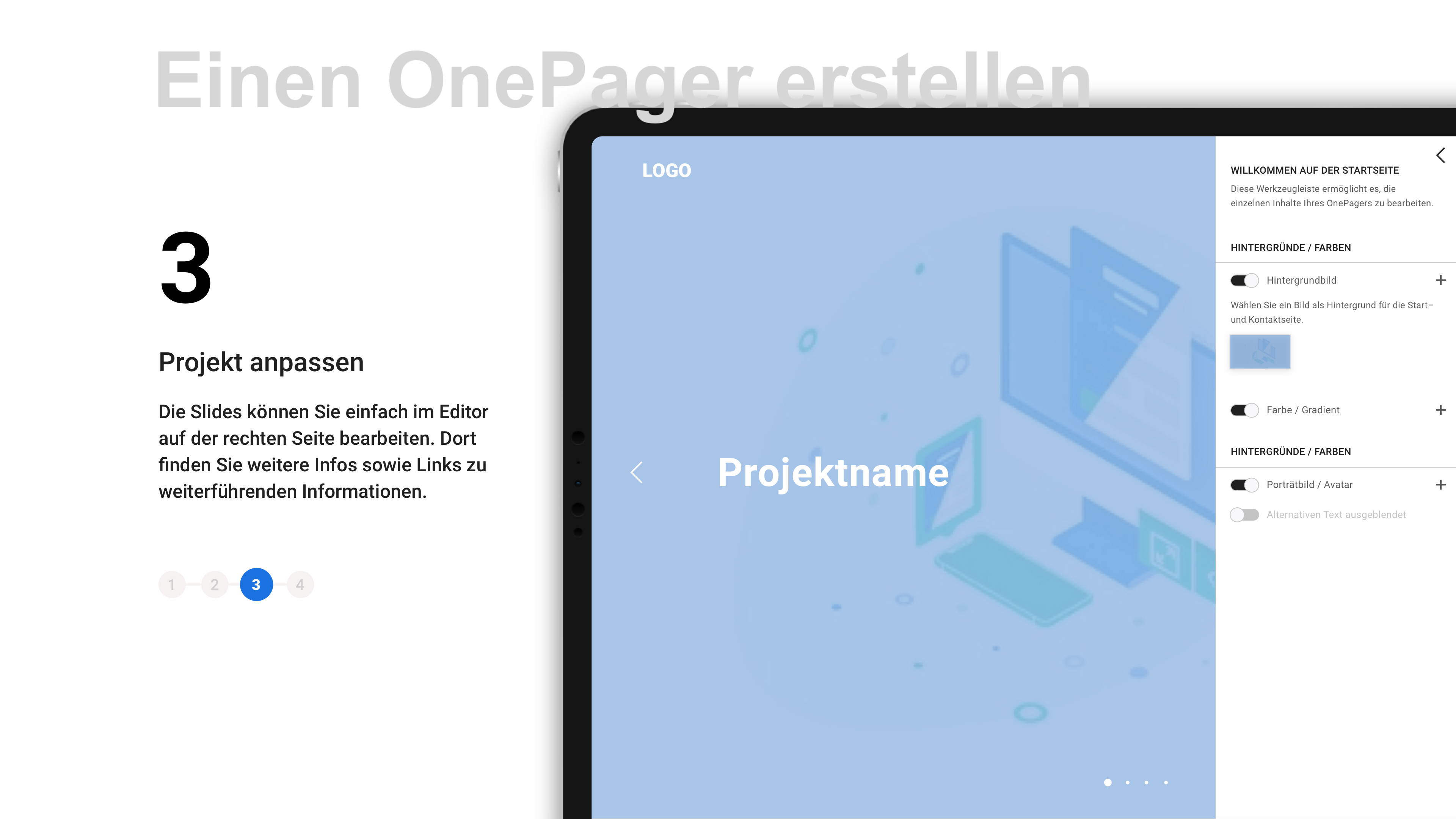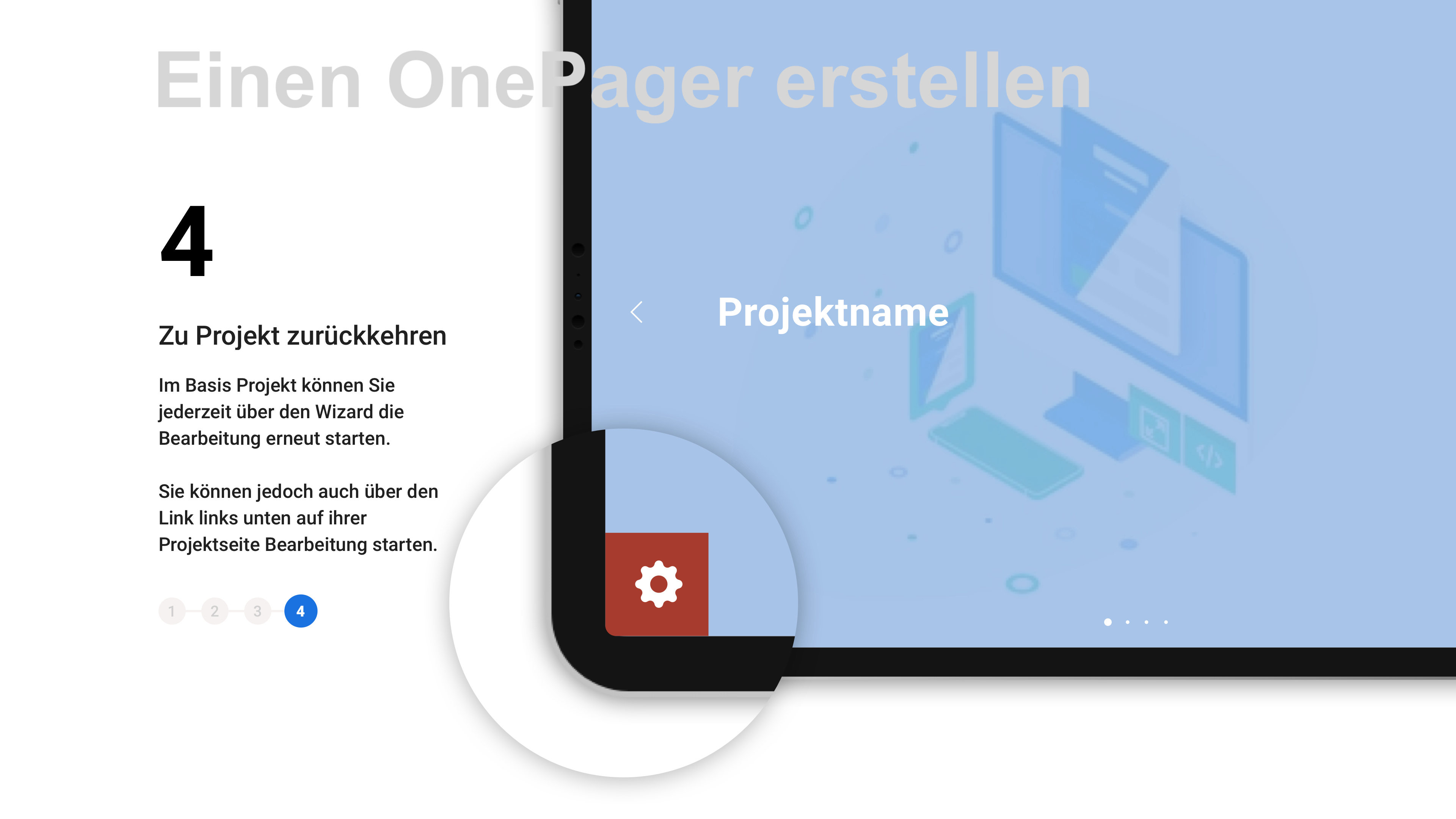AG DOK - Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V.
Schweizer Straße 6
D-60594 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 623 700
"Ich dachte, ich sterbe als Filmemacherin"
Beitrag von Petra Welzel in "Verdi publik" zum Thema Filmförderung und Nachwuchs
from 10.11.2022
Filmförderung — Wie ausgezeichneten Talenten wie Natalija Yefimkina das Drehen von Kinodokumentarfilmen schwer gemacht wird
Von Petra Welzel | 3. November 2022 in "Verdi publik"
Natalija Yefimkina kündigt gerade alles, Netflix, Berufsverbände, alles, was sie nicht unbedingt benötigt. Sie muss sparen. Natalija ist Dokumentarfilmerin – eine ausgezeichnete. Für ihren ersten Kinodokumentarfilm "Garagenvolk", einen Film über ganz besondere und teils sonderbare Menschen im hohen Norden Russlands, streicht sie seit der Uraufführung auf der Berlinale 2020 immer wieder Preise ein. Zuletzt von der ver.di-Filmunion im September den Deutschen Fairnesspreis. Von den Preisgeldern beglich Natalija vor allem Schulden.
"Ich habe oft das Gefühl, das ist mein letzter Film gewesen", sagt sie an einem warmen Oktobertag im Atelier ihres Mannes in einer Berliner Altbauwohnung. Die Wände sind grau, die Holztüren und Fensterrahmen aus dunkelbraunem Eichenholz, oben entlang der Wand zieht sich ein düsterer Fries mit Jagdszenen. Natalija sitzt auf einem alten Ledersofa, vor ihr auf dem Tisch liegen ein paar Äpfel, Quitten, auf einem Teller luftgetrocknete Feigen, in einer Schüssel Weintrauben. Es ist ein Bild wie in einem dieser dunklen Stillleben aus dem 17. Jahrhundert.
In Natalijas Film reihen sich andere stille Bilder aneinander. Man folgt ihnen gespannt 95 Minuten lang. Was in minutenlangen Einstellungen auf jede einzelne Person zu sehen ist, führt die Zuschauerin in eine Parallelwelt, die sich weitestgehend hinter Garagentoren abspielt. Dort sind keine Autos geparkt, es werden Wachteln gezüchtet, Hanteln geschmiedet, Schrott ausgeschlachtet und unterirdische Räume geschaffen.
Es gibt zwei Männer, die in Wehrmachtsklamotten und mit Gewehren in die Berge hinter den Garagen klettern und dort 2. Weltkrieg spielen. Der Schrotthändler streitet sich ständig mit seinem Helfershelfer, der zu viel trinkt, aber im Suff stets kluge Sachen sagt. Und da sind die jungen Leute, die in zwei Garagen Punk machen und von einem cooleren Leben in Moskau, St. Petersburg oder einer anderen Großstadt träumen.
Ausgeträumt
Seitdem ihr Film Erfolge feiert, hat auch Natalija einen Traum: Es würde nun leichter, Dokumentarfilme für die große Leinwand zu drehen. Mehr als zwei Jahre hat es gebraucht, die Fördergelder für ihren Erstling zusammenzubekommen. Ein weiteres Jahr Arbeit samt Dreh und Schnitt schlossen sich an. Ihr Verdienst: 25.000 Euro plus die Preisgelder. Wer kann davon leben? Ihre Mutter habe während der Arbeit am Film ihre Miete bezahlt, eine Freundin habe ihr Geld geschenkt mit den Worten "du musst diesen Film machen".
Ihr Film ist auch ausgezeichnet mit dem Prädikat "besonders wertvoll". Nur: Anständig bezahlt wird sie für ihre wertvolle Arbeit nicht. Und: "Niemand ist gekommen und hat gefragt, willst du deinen nächsten Film mit uns machen", sagt Natalija. Die Hoffnung, dass der Erfolg ihr schneller Türen öffne, sich ein neuer Film einfacher finanzieren ließe, hat sich bisher nicht erfüllt.
In den letzten zwei Jahren hat Corona zudem all ihre Bemühungen ausgebremst, dann im Februar der Krieg, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Sie hatte keinen Kopf für Anträge. "Ich dachte, ich sterbe als Filmemacherin", sagt Natalija, von der man an dieser Stelle wissen muss, dass sie in der Ukraine geboren ist.
Auf Pump
Egal wie schwarz Natalija ihre Situation betrachtet, sie lacht oft, selbst wenn sie sagt, es werde gleich "ernst und traurig". Mit ihrer kraftvollen und tiefen Stimme sagt sie: "Ich kann nichts anderes machen als Filme. Das ist das, was ich am besten kann." Und weil das so ist, hat sie ihren zweiten Film jetzt auf Pump gedreht. Kameramann, Tonmann, Cutterin – sie verzichten vorerst auf ihre Bezahlung.
Fragt man David Bernet, Co-Vorsitzender der AG DOK, dem Berufsverband Dokumentarfilm, und selbst seit 24 Jahren Dokumentarfilmer, warum es Natalija so schwer hat, sagt er: "Das ist, wie man in Deutschland mit hervorragenden Talenten umgeht. Sie lernen von Anfang an, dass sie nicht gewertschätzt werden." Er kennt Natalija und ihren Film. Der sei herausragend. "Er besteht aus lauter magischen Momenten." Ihre Herangehensweise sei die reine Beobachtung. "Sie war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort." Für solche Bilder brauche es viel Zeit und die müsse bezahlt werden.
25.000 Euro Filmhonorar hält David für völlig unangemessen. Von 75.000 Euro könnte Natalija vielleicht leben, "aber es wäre immer noch kein ausreichendes Gehalt für so eine kreative Arbeit". Die Budgets seien gewöhnlich einfach zu klein für eine faire Vergütung. Die Filmlandschaft in Deutschland sei so strukturiert, dass freie Produktionsfirmen möglichst viele Filme produzieren müssen, anstatt möglichst hohe Qualität zu liefern, die sie anständig vergüten können. Zudem: Die öffentlich-rechtlichen Sender ziehen sich immer mehr aus Kino-Koproduktionen heraus und wenn sie sich beteiligen, dann mit immer kleineren Beträgen.
Das sagt auch Natalija. Sie rutscht an die vordere Sitzkante des Sofas, der Punkt regt sie auf. Aber ohne Sender gehe es eben nicht. Die Förderer machen ihre Beteiligung meist davon abhängig. Und so entscheiden die Sender im Vorfeld, für welches Filmprojekt überhaupt Fördergelder beantragt werden können. Ist eine Entscheidung gefallen, gebe es am Ende aber nicht einmal Sendeplätze für Filme wie ihre.
Ausgestrahlt
Tatsächlich wurde das "Garagenvolk" beim Mitteldeutschen Rundfunk, der sich zusammen mit arte die Verwertungsrechte sicherte, ein einziges Mal um 2 Uhr 30 am Morgen ausgestrahlt. "Wer guckt da fern?", fragt Natalija. Und auf arte wurde nur eine gekürzte Fassung gezeigt. "Wenn selbst arte kürzt, der Sender, der die Kunst im Namen trägt, immer weniger Sendeplätze für lange kreative Dokumentarfilme hat, zeigt das, wo wir stehen", sagt David.
Bei arte heißt es, es sei üblich, Filme, die eine Förderung erhalten und in Kinofassung entstehen, in einer kürzeren Fassung zu senden. Natalijas Film lief so auf nahezu die Hälfte eingedampft auf dem Sendeplatz "Wunderwelten" unter dem Titel "Meine Garage, mein Paradies". Mit dem ursprünglichen Film hat diese Fassung nicht mehr viel zu tun.
Die fehlende Wertschätzung fühlt sich für Natalija viel schlimmer an als die miese Bezahlung. "Ich brauche nicht viel zum Leben", sagt sie. Sie zeigt auf ihren langen dunkelblauen Wollmantel und sagt, den habe sie geschenkt bekommen. Das gelbe Tuch um ihren Hals habe sie auf der Straße gefunden. Menschen und Filme über sie machen, das ist ihr wichtig.
Ausschlaggebend
Natalija war drei Jahre alt, als sich im April 1986 in Tschernobyl, 80 Kilometer entfernt von Kiew, wo sie damals mit ihrer Familie lebte, die Reaktorkatastrophe ereignete. Ihre Eltern, Biochemiker, besaßen einen Geigerzähler. Dessen Ausschlag veranlasste ihre Mutter, sich ins tiefste Sibirien in die Taiga an den Baikalsee versetzen zu lassen. Drei Jahre lebten sie dort, anfangs in einer Waldhütte, mit Pferden, Kühen, die Wäsche wurde mit der Hand gewaschen. Natalija erinnert sich an ein "wildes Leben". Immer draußen sein, wenn es nicht -30 Grad hatte. Man versucht sich die große Frau von heute mit ihren weizenblonden langen Haaren als kleines Mädchen im tiefsten Sibirien vorzustellen, wie sie alles mit neugierigen Blicken beobachtet. So wie Natalija heute mit ihren Filmen in Welten vordringt, die kaum jemand sonst so sieht. "Unser Beruf ist der schönste der Welt", sagt David. "Wir werden von der Realität belehrt."
Nur: Diesem Beruf nachzugehen, ist schwer. Die Filmförderung in Deutschland beruht seit 1967 auf dem Filmförderungsgesetz (FFG). Ein öffentlich-rechtlicher Sender muss zuerst gefunden werden, auf einen regionalen Förderer ist man angewiesen, selbst wenn im Ausland gedreht wird. Die Verfahren sind kompliziert, kleinteilig und aufwendig, und die einzelnen Fördergelder sind so eng bemessen, dass am Ende viele verschiedene Förderungen nötig sind. Und alle Förderer äußern Ansprüche an das Projekt. Für die Filmemacher*innen bedeutet das häufig, Kompromisse einzugehen.
"Du gibst auch alle deine Rechte ab, an die Produktionsfirma, an den Sender, an den Verleih. Auch an der Verwertung meines Films bin ich nicht beteiligt", sagt Natalija. Die aber fordert sie und höhere Gagen. Die ganze Branche warte auf "echte tektonische Verschiebungen" in der Filmförderung, sagt David. Eine Novellierung des FFG ist eingeleitet. Die Staatsministerin für Kultur hat Ende Oktober eine umfassende Überarbeitung angekündigt, die den unabhängigen Filmschaffenden größeren wirtschaftlichen und kreativen Freiraum verschaffen soll.
Natalijas zweiter Film ist mittlerweile fast fertig. Ob sie ihn wird zeigen können, ist offen, dafür müsste ein Sender ihn kaufen. Als sie das Atelier verlässt und auf die Straße tritt, trägt sie auf dem Kopf zum gelben Schal eine blaue Wollmütze, beides in den Farben der ukrainischen Flagge. Mit ihrer Größe von 1,90 Metern ist sie nicht zu übersehen, die Filmemacherin, die ihren Weg geht.
Foto: Renate Kossmann